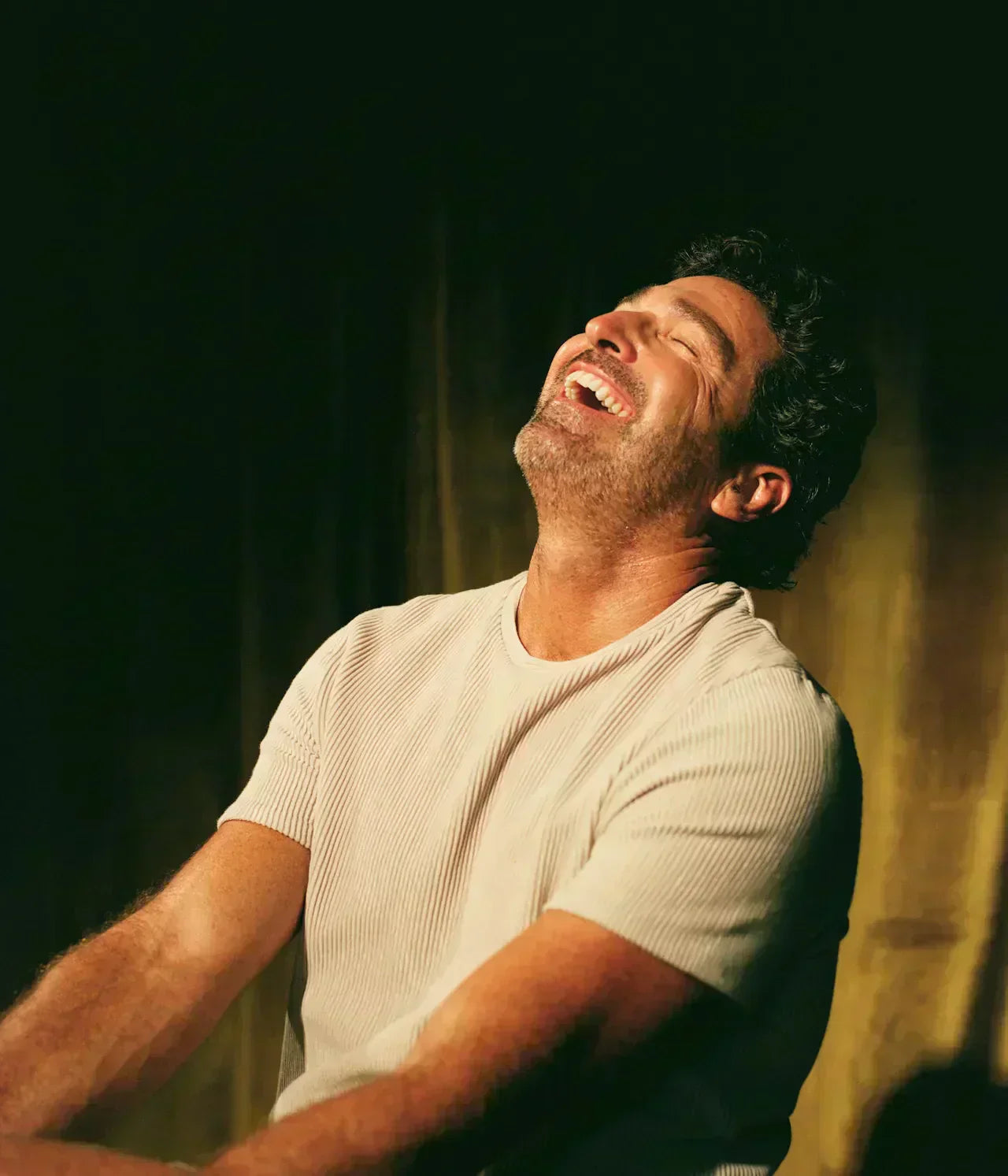
Sorbitintoleranz erkennen: Wenn der Bauch mehr weiß als das Labor
Viele Menschen leiden über Jahre hinweg an wiederkehrenden Bauchbeschwerden: Blähungen, Krämpfe, Durchfall oder ein unangenehmes Völlegefühl nach dem Essen. Oft lautet die Diagnose: Reizdarmsyndrom – oder noch vager „funktionelle Störung“. Die Laborwerte sind normal, der Ultraschall zeigt nichts Auffälliges, und auch bei der Magenspiegelung oder Koloskopie findet sich keine krankhafte Veränderung. Trotzdem bleibt das Gefühl: „Irgetwas stimmt mit meinem Bauch nicht.“
In dieser Situation fühlen sich viele allein gelassen. Sie haben bereits verschiedene Diäten ausprobiert, manche verzichten auf Gluten, andere auf Laktose – oft ohne nachhaltige Verbesserung. Was dabei häufig übersehen wird: Eine Sorbitintoleranz kann hinter all diesen Beschwerden stecken. Und sie wird erstaunlich oft gar nicht erst untersucht.
Dabei ist Sorbit (auch Sorbitol genannt) in vielen Lebensmitteln enthalten – sowohl natürlich als auch künstlich zugesetzt. Wer empfindlich darauf reagiert, spürt nach dem Verzehr typische Symptome wie Blähungen, Völlegefühl, Durchfall oder Bauchkrämpfe. Doch diese Symptome treten oft zeitverzögert auf, was die Zuordnung erschwert.
In diesem Artikel erfährst Du, was Sorbit eigentlich ist, wie sich eine Unverträglichkeit bemerkbar macht, warum sie so häufig übersehen wird – und wie Du durch einen gezielten Test endlich Klarheit gewinnen kannst. Denn: Du musst Deine Beschwerden nicht einfach hinnehmen.

Was ist Sorbit überhaupt – und warum betrifft es so viele?
Sorbit (oder Sorbitol) ist ein sogenannter Zuckeralkohol, chemisch verwandt mit Glukose. Er kommt in der Natur in kleinen Mengen in vielen Obstsorten vor – zum Beispiel in Äpfeln, Birnen, Pflaumen oder Datteln. In der Lebensmittelindustrie wird Sorbit aber auch künstlich hergestellt und als Zuckeraustauschstoff verwendet. Er trägt die E-Nummer E 420.
Weil Sorbit süß schmeckt, aber nur wenig Insulin benötigt und kalorienärmer ist als Zucker, wird es gern in Diabetikerprodukten, „zuckerfreien“ Süßigkeiten, Kaugummis oder auch in Zahnpasta verwendet. Doch das vermeintlich gesunde Image kann trügen – denn Sorbit ist schwer verdaulich.
Der menschliche Dünndarm kann Sorbit nur begrenzt aufnehmen. Wird mehr Sorbit aufgenommen, als resorbiert werden kann, gelangt der Zuckeralkohol unverdaut in den Dickdarm. Dort wird er von Bakterien vergoren – es entstehen Gase wie Wasserstoff (H₂), Methan und Kohlendioxid. Das kann zu Blähungen, Bauchschmerzen und Durchfall führen.
Besonders problematisch ist, dass viele Menschen eine individuell sehr niedrige Toleranzgrenze haben. Schon kleine Mengen – etwa ein Apfel oder ein Diätprodukt – können Symptome auslösen. Und da Sorbit in sehr vielen verarbeiteten Lebensmitteln vorkommt, ist es für Betroffene oft kaum möglich, die Ursache selbst zu erkennen.
Noch komplizierter wird es, wenn gleichzeitig eine Fruktose- oder Histaminintoleranz besteht – denn diese Kombinationen kommen häufig vor. Genau deshalb ist eine gezielte Diagnostik so wichtig.

Du möchtest wissen, ob Sorbit die Ursache Deiner Beschwerden ist?
Mit unserem ärztlich begleiteten Sorbit-Atemtest bekommst Du endlich Klarheit – bequem von zu Hause und wissenschaftlich zuverlässig.
Sorbitintoleranz – eine unterschätzte Ursache für viele Beschwerden
Die Begriffe Sorbitintoleranz, Sorbitunverträglichkeit oder Sorbitmalabsorption werden oft synonym verwendet – auch wenn sie medizinisch leicht unterschiedliche Bedeutungen haben. Entscheidend ist: Der Dünndarm schafft es nicht, Sorbit vollständig aufzunehmen, und der verbleibende Anteil wird im Dickdarm vergoren. Die entstehenden Gase und Abbauprodukte reizen die Darmschleimhaut, verändern die Darmbewegung und können Entzündungen begünstigen.
Anders als bei Allergien gibt es bei der Sorbitintoleranz keinen immunologischen Mechanismus. Die Beschwerden treten also nicht durch eine Abwehrreaktion des Körpers auf, sondern rein durch die mechanischen und chemischen Folgen im Darm.
Typische Symptome können sein:
-
Blähungen, Völlegefühl, Aufstoßen
-
Krampfartige Bauchschmerzen
-
Durchfall oder breiiger Stuhl
-
Übelkeit
-
Unregelmäßiger Stuhlgang
-
Ständiges „Grummeln“ oder „Rumoren“ im Bauch
Oft wird diese Symptomatik als „Reizdarm“ klassifiziert – insbesondere, wenn keine auffälligen Labor- oder Bildbefunde vorliegen. Doch während das Reizdarmsyndrom eine Ausschlussdiagnose ist, lässt sich eine Sorbitintoleranz gezielt testen. Leider passiert genau das viel zu selten.
Ein weiteres Problem: Viele Betroffene gewöhnen sich an ihre Beschwerden. Sie akzeptieren ein tägliches Völlegefühl oder ständiges Unwohlsein als „normal“. Dabei ist Lebensqualität möglich – wenn man weiß, was im Körper passiert.

Welche Symptome treten bei Sorbitunverträglichkeit auf?
Die Beschwerden bei einer Sorbitintoleranz sind sehr unterschiedlich – sowohl in ihrer Art als auch in ihrer Intensität. Einige Menschen merken schon nach wenigen Minuten ein Völlegefühl oder Blähungen, andere reagieren erst Stunden später mit Durchfall oder Bauchkrämpfen. Diese Variabilität macht es so schwierig, die Ursache selbst zu erkennen.
Die häufigsten Symptome lassen sich in drei Gruppen einteilen:
Verdauungsbeschwerden im Magen-Darm-Trakt
Diese sind am weitesten verbreitet und treten bei fast allen Betroffenen auf. Dazu gehören:
-
Blähungen – meist durch Gasbildung im Dickdarm, häufig verbunden mit sichtbarer Bauchvergrößerung
-
Krämpfe – typischerweise im Unterbauch, oft wellenartig
-
Durchfall – manchmal sofort, manchmal erst am Folgetag
-
Unregelmäßiger Stuhlgang – zwischen Durchfall, breiigem Stuhl und Phasen ohne Stuhl
-
Völlegefühl und Rumoren – vor allem nach Obst, Süßigkeiten oder Diätprodukten

Begleitende Allgemeinsymptome
Viele Menschen berichten zusätzlich über Beschwerden, die auf den ersten Blick nicht mit dem Darm zusammenhängen. Dazu zählen:
-
Kopfschmerzen
-
Schwindelgefühle nach dem Essen
-
Konzentrationsprobleme oder „Gehirnnebel“
-
Stimmungsschwankungen
-
Antriebslosigkeit oder schnelle Erschöpfung
Diese Symptome könnten durch die Auswirkungen der Gärprozesse im Darm erklärt werden, etwa durch die Freisetzung von kurzkettigen Fettsäuren, Entzündungsbotenstoffen oder durch die gestörte Resorption anderer Nährstoffe.
Spätsymptome oder chronische Beschwerden
Besonders bei langjähriger Belastung ohne Diagnose kommt es oft zu folgenden Problemen:
-
Chronische Reizdarmbeschwerden mit wechselndem Verlauf
-
Essensangst („Ich weiß nicht, was ich noch essen kann.“)
-
Soziale Rückzüge wegen Blähungen oder Toilettenproblemen
-
Fehl- oder Mangelernährung, etwa bei Vermeidung ganzer Lebensmittelgruppen
-
Vermeintliche Lebensmittelallergien (häufig falsche Selbstdiagnose)
Viele dieser Symptome überschneiden sich mit anderen Intoleranzen – etwa Fructose, Histamin oder Laktose. Genau deshalb wird die Sorbitintoleranz oft nicht erkannt, obwohl sie in Kombination sehr häufig vorkommt.

Sorbitintoleranz und Gewichtszunahme – ein übersehener Zusammenhang?
Es klingt paradox: Wie kann es sein, dass man durch ein Nahrungsmittel, das zu Durchfall führt, an Gewicht zunimmt? Und doch berichten viele Menschen mit Sorbitintoleranz über genau dieses Phänomen. Die Ursachen sind vielschichtig:
1. Blähbauch und Wassereinlagerungen werden oft als „Gewicht“ wahrgenommen
Nach dem Essen von sorbitreichen Lebensmitteln kann der Bauch innerhalb weniger Stunden deutlich anschwellen – teils um mehrere Zentimeter. Die Kombination aus Gasbildung und Wassereinlagerung im Darmbereich sorgt für ein Völlegefühl, das Betroffene oft als „Zunahme“ empfinden.
Messungen zeigen: Diese Schwellung kann kurzfristig 1–2 kg Unterschied auf der Waage verursachen, ohne dass tatsächlich Fett aufgebaut wurde. Der Begriff „Gewichtszunahme“ ist hier also irreführend – aber das Gefühl bleibt real.
2. Vermeidungsverhalten und Heißhungerattacken
Wer unter ständigem Völlegefühl oder Durchfällen leidet, beginnt oft, viele Lebensmittel zu meiden – auch solche, die eigentlich gut vertragen würden. Das kann zu einseitiger Ernährung führen. Gleichzeitig entstehen Heißhungerattacken, etwa auf fettige oder süße Speisen, die keine Beschwerden verursachen – aber auch kaum sättigen.
3. Chronische Entzündungsprozesse im Darm
Unverträglichkeiten wie Sorbitintoleranz können bei ständiger Belastung zu einer Reizung der Darmschleimhaut führen. Studien zeigen, dass diese Entzündungsprozesse mit metabolischen Veränderungen verbunden sein können – etwa mit einer erhöhten Insulinresistenz. Das begünstigt Gewichtszunahme, selbst wenn man nicht übermäßig isst.
4. Falsche Diäten als Reaktion
Ein weiterer Aspekt: Viele Betroffene versuchen, mit Low-Carb-, Clean-Eating- oder glutenfreien Diäten ihre Beschwerden zu kontrollieren. Oft enthalten diese Diäten aber Produkte mit hohem Sorbitanteil – etwa Proteinriegel, Light-Joghurts oder Diät-Süßigkeiten. Die Folge: Trotz Verzicht auf „normale“ Ernährung treten Beschwerden weiter auf – und der Frust über das scheinbare „Zunehmen trotz Disziplin“ steigt.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Eine Sorbitintoleranz kann durchaus zu einer gefühlten oder tatsächlichen Gewichtszunahme führen, insbesondere wenn die Beschwerden zu falschen Essgewohnheiten, Mangelernährung oder Stressreaktionen führen.

Wenn Sorbit nicht allein verantwortlich ist – Mischintoleranzen erkennen
Viele Menschen, die unter einer Sorbitintoleranz leiden, reagieren auch auf andere schwer verdauliche Zuckerarten. Das liegt daran, dass der Verdauungstrakt – insbesondere der Dünndarm – oft mehrere Resorptionsstörungen gleichzeitig aufweist. Am häufigsten treten folgende Kombinationen auf:
Fructose- und Sorbitintoleranz
Diese Kombination ist besonders verbreitet. Beide Zuckerarten – Fructose (Fruchtzucker) und Sorbit (Zuckeralkohol) – werden über ähnliche Transportmechanismen im Dünndarm aufgenommen. Das Problem: Sorbit hemmt nachweislich die Aufnahme von Fructose. Wer also Fructose noch relativ gut verträgt, kann durch Sorbit plötzlich Beschwerden bekommen, obwohl gar keine Fructosemenge erhöht wurde.
Typisches Beispiel: Ein Apfel enthält sowohl Fructose als auch Sorbit – und genau diese Kombination führt bei vielen zu starken Blähungen oder Durchfall. Wer also auf Sorbit reagiert, sollte auch Fructose als mögliche Zusatzursache in Betracht ziehen.

Histaminintoleranz und Sorbit
Auch bei Histaminintoleranz kann eine Sorbitintoleranz zusätzlich vorliegen – und die Situation verschärfen. Beide führen zu Reizungen der Darmschleimhaut, und die durch Sorbit ausgelöste Gärung kann Entzündungsprozesse verstärken. Wer nach Sorbitkonsum nicht nur Blähungen, sondern auch Kopfschmerzen, Hautausschläge oder Kreislaufprobleme bekommt, sollte auch eine Histaminunverträglichkeit in Betracht ziehen.
Laktoseintoleranz und Sorbit
Auch diese Kombination kommt vor. Da sowohl Laktose als auch Sorbit Gase im Dickdarm erzeugen, kann es zu einer Verstärkung der Beschwerden kommen. Das bedeutet aber nicht, dass alle Zuckerarten pauschal vermieden werden müssen – sondern dass die Toleranz individuell geprüft werden sollte.
Was heißt das für die Praxis?
Wenn Du auf bestimmte Obstsorten, Süßigkeiten, Fertigprodukte oder Light-Lebensmittel reagierst, reicht es nicht aus, nur nach einem einzelnen Inhaltsstoff zu suchen. Viel wahrscheinlicher ist, dass mehrere Unverträglichkeiten zusammenwirken – oder sich gegenseitig verstärken.
Beispiel:
-
Datteln: enthalten viel Fructose und Sorbit
-
Light-Kaugummis: enthalten oft Sorbit, Mannit und Aspartam
-
Proteinriegel: oft Sorbit und künstliche Aromen
Hier hilft nur eine gezielte Diagnostik – idealerweise mit Einzeltests für Sorbit, Fructose, Laktose und ggf. Histamin. Nur so lässt sich ein klarer Zusammenhang herstellen.

Medikamente und Zahnpflege: Versteckte Sorbitquellen im Alltag
Viele Menschen achten bei ihrer Ernährung auf Inhaltsstoffe – und übersehen dabei die häufigsten versteckten Sorbitquellen: Zahnpasta, Mundspülungen, Lutschtabletten oder sogar Medikamente. Sorbit wird dort nicht als Süßungsmittel verwendet, sondern als Feuchthaltemittel oder Füllstoff.
Typische Produkte mit verstecktem Sorbit:
-
Zahnpasta (vor allem für Kinder und „sensitive“-Produkte)
-
Mundspülungen („ohne Alkohol“ heißt nicht automatisch sorbitfrei)
-
Halstabletten oder Schmerztabletten zum Lutschen
-
Vitaminpräparate zum Kauen
-
Abführmittel und Elektrolyt-Lösungen
-
Medikamente mit Fruchtgeschmack
Einige dieser Produkte enthalten mehrere Gramm Sorbit pro Anwendung – was für viele bereits die Toleranzschwelle übersteigt. Die Aufnahme erfolgt dabei nicht nur über den Magen-Darm-Trakt, sondern auch über die Schleimhäute – besonders problematisch bei täglicher Anwendung.
Was tun?
-
Inhaltsstoffe genau lesen: „Sorbit“, „Sorbitol“, „E 420“
-
Mundpflegeprodukte mit Kennzeichnung „ohne Sorbit“ bevorzugen
-
Apotheker gezielt nach Alternativen fragen
-
Beipackzettel von Medikamenten prüfen – auch rezeptfreie!
Wer trotz Diät weiterhin Beschwerden hat, sollte diese oft übersehenen Quellen unbedingt überprüfen. In vielen Fällen verschwinden chronische Symptome erst dann vollständig, wenn auch diese Sorbitmengen vermieden werden.

Was sagt der Hausarzt? Warum Diagnosen oft ausbleiben
Viele Menschen, die unter Verdauungsproblemen leiden, wenden sich irgendwann an ihre Hausärztin oder ihren Hausarzt – in der Hoffnung auf eine klare Diagnose und eine zielgerichtete Therapie. Doch gerade bei Sorbitintoleranz erleben viele eine Enttäuschung: Die Beschwerden werden nicht ernst genommen, als „stressbedingt“ abgetan oder mit einer allgemeinen Reizdarmdiagnose abgegolten. Warum ist das so?
1. Sorbitintoleranz ist keine Standarddiagnose
In der hausärztlichen Routineversorgung gibt es für typische Magen-Darm-Beschwerden standardisierte Diagnoseschritte: Anamnese, Blutuntersuchung, Ultraschall, eventuell eine Überweisung zur Magen- oder Darmspiegelung. Finden sich keine Auffälligkeiten, wird meist das Reizdarmsyndrom vermutet – das heißt aber auch: Intoleranzen wie Sorbit werden nicht automatisch abgeklärt, obwohl sie in Studien häufig nachgewiesen werden.
Der Grund liegt unter anderem darin, dass Sorbitintoleranz keine „klassische“ Krankheit mit Gewebeveränderungen ist, sondern eine funktionelle Störung der Resorption. Und für solche Beschwerden gibt es bislang keinen festen Platz in Leitlinien oder in der Routinekassenversorgung.

2. Der Atemtest wird selten angeboten
Ein Sorbit-Atemtest, bei dem die Wasserstoffkonzentration in der Ausatemluft nach Einnahme von Sorbit gemessen wird, gilt als zuverlässige Methode. Aber: Er wird meist nicht in Hausarztpraxen angeboten – weder aus Zeitgründen noch aufgrund fehlender technischer Ausstattung.
Viele Hausärzt:innen kennen den Test, führen ihn aber nicht selbst durch. Sie erwarten, dass die Patient:innen sich an Spezialist:innen wenden – was in der Praxis bedeutet, dass Monate bis zur Testung vergehen können. Manche Patient:innen erhalten gar keine Empfehlung dafür.
3. Die Symptome sind unspezifisch – und werden oft bagatellisiert
Blähungen, Durchfall oder Bauchdrücken sind keine klassischen „Alarmsymptome“. Sie werden oft mit Stress, falscher Ernährung oder Reizdarm erklärt – vor allem, wenn keine sichtbaren Entzündungen oder auffällige Laborwerte vorliegen.
Hinzu kommt, dass viele Betroffene mit ihren Beschwerden zurechtkommen – sie stellen sich auf „ihren Bauch“ ein, ohne jemals eine fundierte Abklärung zu erhalten. Das führt zu einer erheblichen Dunkelziffer.
4. Die Betroffenen sind oft selbst aktiv – aber ohne System
Viele versuchen, durch eigene Diäten herauszufinden, was ihnen bekommt. Doch das Problem bei Sorbit: Es ist in so vielen verschiedenen Lebensmitteln versteckt, dass eine gezielte Vermeidung ohne fundiertes Wissen kaum möglich ist. Zudem treten Beschwerden oft erst Stunden später auf, was die Zuordnung erschwert.
Ein weiterer Fehler: Manche Menschen verzichten auf Gluten oder andere Zutaten, obwohl sie gar nicht die eigentliche Ursache sind – mit dem Ergebnis, dass der Erfolg ausbleibt und die Ernährung unnötig eingeschränkt wird.
Fazit: Wer eine Sorbitintoleranz vermutet, sollte sich nicht nur auf die ärztliche Standarddiagnostik verlassen, sondern gezielt nach dem Atemtest fragen. Noch besser: Selbst aktiv werden.
Im nächsten Abschnitt zeige ich Dir, wie genau der Sorbit-Atemtest funktioniert – und warum er Dir endlich Klarheit verschaffen kann.

Der Weg zur Diagnose: Sorbit-Atemtest als zuverlässige Methode
Wenn typische Beschwerden immer wieder nach dem Verzehr bestimmter Lebensmittel auftreten – etwa nach Obst, Diätprodukten, zuckerfreien Bonbons oder Kaugummis – dann kann ein Sorbit-Atemtest helfen, die Ursache eindeutig zu klären.
Dieser Test misst, ob der Körper Sorbit richtig aufnehmen kann oder ob es im Dickdarm vergoren wird. Dabei wird nicht das Blut untersucht, sondern die Wasserstoffkonzentration in der Ausatemluft, denn beim bakteriellen Abbau von Sorbit im Dickdarm entsteht unter anderem Wasserstoffgas (H₂), das über das Blut zur Lunge gelangt und ausgeatmet wird.
Wie funktioniert der Test?
Ein Sorbit-Atemtest ist ein standardisiertes Verfahren, das unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt wird. Hier ein typischer Ablauf:
1. Vorbereitung am Vortag
-
Letzte Mahlzeit am Vorabend sollte leicht verdaulich sein (keine Ballaststoffe, keine Hülsenfrüchte, kein Obst, kein Alkohol)
-
12 Stunden vor dem Test nüchtern bleiben (nur stilles Wasser ist erlaubt)
-
Keine Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel mit Zuckeralkoholen (z. B. Sorbit, Xylit)
2. Testtag – nüchtern beginnen
-
Morgens in der Praxis oder zu Hause (bei Heimtest): Basismessung der Ausatemluft im nüchternen Zustand
-
Danach Einnahme einer definierten Menge Sorbit in Wasser gelöst (meist 5–10 g)
3. Atemproben über 2 bis 3 Stunden
-
Alle 15–30 Minuten wird eine Atemprobe in ein Messgerät oder ein Probenröhrchen abgegeben
-
Die Wasserstoffkonzentration (in parts per million, ppm) wird gemessen
4. Auswertung
-
Ein Anstieg von ≥20 ppm über dem Nüchternwert gilt als Hinweis auf eine Sorbitmalabsorption
-
Begleitend werden Symptome dokumentiert (Blähungen, Bauchschmerzen, Durchfall während des Tests)

Was kann der Test zeigen – und was nicht?
Der Sorbit-Atemtest zeigt, ob und wie stark der Körper auf Sorbit reagiert. Ein positiver Test bedeutet, dass Sorbit im Dünndarm nicht ausreichend aufgenommen wird und im Dickdarm vergärt – mit entsprechenden Beschwerden. Aber: Auch wenn der Test negativ ausfällt, kann es sein, dass bei kleineren Mengen oder in Kombination mit anderen Stoffen trotzdem Beschwerden auftreten.
Daher ist nicht nur die Messung der H₂-Werte entscheidend, sondern auch die Symptomdokumentation. Wenn während des Tests typische Beschwerden auftreten – selbst bei grenzwertigem H₂-Anstieg – spricht das trotzdem für eine Unverträglichkeit.
Welche Vorteile hat der Atemtest gegenüber anderen Methoden?
-
Nicht-invasiv: keine Blutentnahme, keine Endoskopie
-
Direkte Bewertung der Verdauung in Echtzeit
-
Objektive Messung mit klaren Grenzwerten
-
Sicher auch für Kinder und Schwangere
Zudem kann der Test bequem von zu Hause aus durchgeführt werden – mit ärztlicher Begleitung, klaren Anleitungen und Rückmeldung nach der Auswertung. Viele Labore, darunter auch spezialisierte Anbieter wie mein Praxislabor, bieten diesen Test als Selbstzahlerleistung an.

Wann ist der Test besonders sinnvoll?
-
Wenn klassische Diagnostik unauffällig war, aber Beschwerden bestehen
-
Wenn Du bestimmte Lebensmittelgruppen im Verdacht hast (Obst, Diätprodukte)
-
Wenn andere Intoleranzen bereits ausgeschlossen oder bestätigt wurden (Fructose, Laktose)
Der Sorbit-Atemtest ist oft der entscheidende Schritt zur richtigen Ernährung – nicht als Diät, sondern als gezielte Entlastung Deines Darms.

Fazit: Du musst Deine Beschwerden nicht länger hinnehmen – Klarheit ist möglich
Viele Menschen leben über Jahre hinweg mit Bauchbeschwerden, die ihren Alltag einschränken: ständige Blähungen, unregelmäßiger Stuhlgang, Druck im Bauch, Essensangst. Nicht selten heißt es: „Das ist halt ein Reizdarm.“ Doch diese Diagnose ist oft nur die letzte Station einer erfolglosen Suche. Was dabei übersehen wird: Eine Sorbitintoleranz kann hinter all diesen Symptomen stecken – und bleibt ohne gezielte Testung unerkannt.
Sorbit ist ein weit verbreiteter Bestandteil moderner Ernährung – nicht nur in Obstsorten wie Äpfeln oder Pflaumen, sondern auch in vielen verarbeiteten Lebensmitteln, Süßstoffen, Zahnpflegeprodukten und Medikamenten. Besonders tückisch: Die Symptome treten oft zeitverzögert auf, die Auslöser sind nicht klar erkennbar, und viele Betroffene gewöhnen sich an ein Leben mit Unwohlsein.

Wenn Du Dich in den hier beschriebenen Beschwerden wiedererkennst, ist der nächste Schritt klar: Lass gezielt testen, ob Dein Körper Sorbit richtig verarbeiten kann. Der Sorbit-Atemtest ist eine sichere, nicht-invasive und zuverlässige Methode, um endlich Gewissheit zu bekommen. Er hilft nicht nur bei der Diagnostik – er gibt Dir die Möglichkeit, gezielt auf belastende Lebensmittel zu verzichten, ohne unnötige Einschränkungen.
Geschrieben von: Bahtier Kurbanov
